
Das deutsche Strafgesetzbuch (kurz: StGB) regelt Straftatbestände der verschiedensten Art. Nicht alle werden gleichermaßen sanktioniert und auch die in Schutz stehenden Rechtsgüter sind jeweils unterschiedliche. Wird bei der Körperverletzung die körperliche Integrität einer Person geschützt, steht beim Betrug hingegen das Vermögen im Schutz des Strafrechts.
In diesem Ratgeber wollen wir uns dem Delikt „Hausfriedensbruch“ zuwenden. Welche Definition liegt dem Begriff zugrunde? Welche Strafe ist für Hausfriedensbruch vorgesehen? Welche Tatbestandsmerkmale müssen erfüllt sein? Wann verjährt die Tat in Deutschland und wonach wird hier differenziert? Lesen Sie im Folgenden die Antworten auf diese und weitere interessante Fragen rund um das Thema „Hausfriedensbruch“.
Inhalt
FAQ: Hausfriedensbruch
Hier können Sie nachlesen, wie genau der Straftatbestand des Hausfriedensbruchs in Deutschland definiert ist.
Wer einen Hausfriedensbruch begeht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe sanktioniert.
Ein versuchter Hausfriedensbruch ist in aller Regel nicht strafbar, da es sich um ein Vergehen handelt.
Rechtliche Grundlage und Strafmaß in Deutschland
Welche Strafe ist bei Hausfriedensbruch zu erwarten? Der Tatbestand ist gesetzlich in § 123 StGB verankert. Der Paragraph ist Teil des 7. Abschnitts des Strafgesetzbuchs, welcher den Titel „Straftaten gegen die öffentliche Ordnung“ trägt. In der Norm selbst heißt es in Absatz 1:
Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, oder wer, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Die für Hausfriedensbruch normierte Strafe von bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe macht aus dem Delikt ein sogenanntes Vergehen. Hierbei handelt es sich um das Gegenstück zum Verbrechen.
Unter einem letzterem ist eine Straftat zu verstehen, die nicht unter einer einjährigen Freiheitsstrafe geahndet wird. Liegt das Strafmaß hingegen unterhalb dessen, ist von einem Vergehen die Rede. Festgelegt ist dies in § 12 Absatz 1 und 2 StGB. Die Unterscheidung ist in vielfacher Hinsicht von Bedeutung, so unter anderem bei der Frage nach der Strafbarkeit einer versuchten Tat. Auch im Strafprozessrecht, etwa bei der Frage nach der Notwendigkeit einer anwaltlichen Verteidigung, ist die Unterscheidung von Belang.
In Betracht kommt also neben der Freiheitsstrafe beim Hausfriedensbruch auch eine Geldstrafe. Wie hoch diese ist, bemisst sich anhand der Gesamtumstände und -betrachtung von Tat und Täter. Eine Rolle spielt hierbei auch sein wirtschaftliches Standbein sowie die Anzahl eventueller Vorstrafen. Je mehr ein Täter hier schon auf dem Buckel hat, umso nachteilhafter. Personen, die hingegen eine bisher weiße Weste vorzuweisen haben, können erfahrungsgemäß mit milderen Strafen rechnen.
Definition: Was ist Hausfriedensbruch gemäß StGB?
Zunächst soll der Begriff „Hausfriedensbruch“ geklärt werden. Was verbirgt sich dahinter? Diesbezüglich gilt das Folgende: Hausfriedensbruch umschreibt die vorsätzliche Verletzung des Rechtsgutes der Unverletzlichkeit befriedeter Besitztümer. Geschützt wird das individuelle Hausrecht einer Person. Jedermann soll frei darüber bestimmen dürfen, wer sich in seinem persönlich geschützten Raum, etwa der eigenen Wohnung, aufhält und für wie lange.
Tatbestandsmerkmale: Ab wann ist es Hausfriedensbruch?

Damit sich ein Täter wegen Hausfriedensbruch strafbar macht, müssen bestimmte Tatbestandsmerkmale erfüllt sein, welche das Gesetz vorgibt. Dabei unterscheidet das StGB in § 123 beim Hausfriedensbruch zwischen zwei verschiedenen Begehungsvarianten: Zum einen steht das vorsätzliche Eindringen in die Räumlichkeiten eines anderen gegen dessen Willen unter Strafe, zum anderen das Sich-nicht-Entfernen trotz entsprechender Aufforderung durch den Berechtigten.
Zu den tatbestandlich geschützten Räumen gehören die Wohnung einer Person, deren Geschäftsräume sowie sonstige befriedete Besitztümer. Hierunter sind Örtlichkeiten zu verstehen, welche nach außen hin erkennbar umgrenzt und gegen unbefugtes Betreten geschützt sind. Uneinigkeit herrscht in der Rechtsprechung dahingehend, welchen Anforderungen eine derartige Umgrenzung genügen muss. Teilweise wird eine Absperrung als ausreichend erachtet, teilweise ein Zaun oder eine Mauer für erforderlich gehalten. Ein Hausfriedensbruch in einem Garten ist ebenfalls möglich, sofern er entsprechend umgrenzt ist.
Zudem sind von der Norm Räume geschützt, die dem Zwecke des öffentlichen Dienstes bzw. Verkehrs dienen. Hierunter fallen beispielsweise Behördengebäude oder aber öffentliche Bahnhöfe. Das Hausrecht übt derjenige aus, der die Verfügungsgewalt innehat. Dies kann neben dem Eigentümer eines Grundstücks auch der Mieter oder Pächter sein. Auch der Vermieter ist gegenüber seinem Mieter nicht gegen dessen Willen zum Verweilen oder Eintreten in die vermietete Wohnung befugt.
Das Betreten mittels eines Zweitschlüssels, von dessen Existenz der Mieter nichts weiß, stellt hierbei ebenfalls einen Fall von § 123 StGB dar. Mitbewohner in Wohngemeinschaften teilen sich das Hausrecht.
Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichtes Hamm (OLG Hamm), welche das Aktenzeichen 11 U 67/15 trägt, war es beispielsweise einem Studenten erlaubt, die Mutter seines Mitbewohners polizeilich aus der Wohnung entfernen zu lassen, die sich während dessen Abwesenheit in der Wohnung niedergelassen hatte. Dies verletze das Hausrecht des Mitbewohners und der Tatbestand „Hausfriedensbruch“ sei erfüllt, so der Senat.
In Bezug auf das Merkmal des Eindringens genügt bereits das Setzen eines Fußes oder eines anderen Körperteils in den geschützten Raum. Nicht vonnöten ist, dass der Täter sich vollständig in ganzer Gestalt darin befindet. Zur Abwehr von Hausfriedensbruch kann sich der Hausherr notfalls mittels Notwehr im Sinne von § 32 StGB verteidigen.
Schwerer Hausfriedensbruch: Schema des § 124 StGB
In § 124 StGB ist der Tatbestand des schweren Hausfriedensbruchs geregelt. Demgemäß gilt Folgendes:
Wenn sich eine Menschenmenge öffentlich zusammenrottet und in der Absicht, Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen mit vereinten Kräften zu begehen, in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, so wird jeder, welcher an diesen Handlungen teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Auch hier müssen bestimmte Tatbestandsmerkmale erfüllt sein. Unter einer Menschenmenge ist eine auf den ersten Blick nicht überschaubare Anzahl von Personen zu verstehen. Eine starre Grenze betreffend der Personenanzahl existiert hier nicht. Der Bundesgerichtshof (kurz: BGH) hat jedenfalls in einer Entscheidung, welche den Tatbestand „Landfriedensbruch“ zum Gegenstand hatte – auch hier ist vom Tatbestandsmerkmal einer Menschenmenge die Rede – diese bei einer Ansammlung von 50 bis 60 Personen angenommen.
Bei einer Zusammenrottung von nur etwa 10 Personen hingegen wurde das Tatbestandsmerkmal als nicht erfüllt erachtet und ein Hausfriedensbruch verneint. Zusammenrotten heißt, sich zwecks eines bestimmten Handelns räumlich zusammenzufinden. Dabei muss das zu erwartende Handeln in seiner bedrohlichen Gestalt bereits erkennbar sein. Die Absicht der Menschenmenge muss in der Ausübung von Gewalt gegen Personen oder Sachen bestehen. Schwerer Hausfriedensbruch sieht als Begehungsform nur das Eindringen vor. Ein Verweilen genügt hier, wie beim einfachen Hausfriedensbruch, indes nicht.
Hausfriedensbruch als Antragsdelikt
Eine Besonderheit des Deliktes ergibt sich aus Absatz 2 des Paragraphen 123. Darin heißt es:
Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
Hausfriedensbruch ist demgemäß ein sogenanntes Antragsdelikt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Straftaten, den Offizialdelikten, greift hier nicht der Grundsatz, dass die Ermittlungsbehörden im Falle der Kenntniserlangung von verdachtsbegründenden Umständen zu Ermittlungen gezwungen sind. Es findet indes eine Durchbrechung des zuvor umschriebenen Legalitätsprinzips statt.
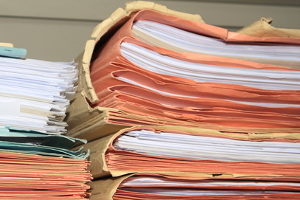
Bei Antragsdelikten wird zwischen absoluten und relativen unterschieden, wobei Hausfriedensbruch zu ersteren zählt. Bei relativen Antragsdelikten kann das Antragserfordernis in bestimmten Fällen auch aufgrund eines besonderen öffentlichen Interesses an einer Strafverfolgung überwunden werden. Antragsberechtigt ist stets der Verletzte der Straftat. Beispielsweise kann der Mieter, der ein Hausverbot ausgesprochen hat, Strafantrag stellen, sofern sich jemand des Verbotes widersetzt hat.
Bei absoluten Antragsdelikten ist dies nicht möglich. Beim Strafantrag kommt das ernsthafte Begehren des Antragstellers zum Ausdruck, dass eine andere Person wegen einer entsprechenden Tat behördlich verfolgt werden soll. Hierin unterscheidet er sich von der Strafanzeige, die lediglich die Mitteilung über einen bestimmten Sachverhalt zum Gegenstand hat.
Wird also kein entsprechender Antrag von Seiten des Hausherrn gestellt, kann Hausfriedensbruch nicht verfolgt und geahndet werden. Allerdings besteht die Möglichkeit, ein Verfahren im Privatklageweg einzuleiten. Hierbei handelt es sich um eine besondere strafprozessuale Verfahrensform, bei der keine öffentliche Klage durch die Staatsanwaltschaft erhoben wird, sondern eben durch den Privatklageberechtigten. Das Verfahren kommt nicht für jeden Tatbestand im deutschen Strafrecht in Betracht. Gesetzlich normiert ist es im ersten Abschnitt des Fünften Buches der Strafprozessordnung (kurz: StPO) und zwar in den Paragraphen 374 bis 394.
Ist versuchter Hausfriedensbruch strafbar?
Nicht alle, aber einige Delikte, sind neben der vollendeten auch in der lediglich versuchten Form strafbar. Wer beispielsweise versucht, eine andere Person zu töten, körperlich zu verletzen oder zu bestehlen, der macht sich strafbar, selbst wenn am Ende doch „nichts passiert“ ist.
Das StGB enthält Regelungen zum Versuch in den Paragraphen 22 bis 24. Hieraus ergibt sich, dass Verbrechen – hierzu zählt beispielsweise der Tatbestand des Mordes oder der des Totschlages – immer im Versuch strafbar sind. Bei Vergehen hingegen muss eine Versuchsstrafbarkeit stets ausdrücklich gesetzlich festgelegt sein.
Für das Delikt Hausfriedensbruch, welches wie eingangs erwähnt ein Vergehen ist, ergibt sich eine derartige gesetzliche Regelung nicht. Ein versuchter Hausfriedensbruch ist mithin nicht strafbar und bleibt ohne strafrechtliche Folgen.
Hausfriedensbruch: Wann tritt Verjährung ein?

Die meisten Straftaten unterliegen einer Verjährung. Differenziert wird begrifflich zwischen Verfolgungs- und Vollstreckungsverjährung. Ersteres besagt, dass nach dem Ablauf einer bestimmten Zeitspanne eine strafrechtliche Verfolgung nicht mehr möglich ist.
Wenn eine Peron beispielsweise einen Diebstahl begeht und die Polizei oder Staatsanwaltschaft kommt erst nach 30 Jahren auf sie als Täter, so sind den Ermittlungsbehörden die Hände gebunden. Der Dieb ist in dem Fall „aus dem Schneider“.
Letzteres hingegen meint, dass eine bereits rechtskräftig ergangene Entscheidung nach dem Ablauf einer bestimmten Dauer nicht mehr vollstreckt werden kann. Angenommen, jemand wird zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, doch diese wird nicht vollstreckt, so kann dies nach Verstreichen der Verjährungsfrist nicht mehr nachgeholt werden.
Eine Verjährung dient damit dem Rechtsfrieden. Doch wonach bemessen sich die jeweiligen Fristen und wie lang sind diese beim Hausfriedensbruch?
Die Frist zur Verfolgungsverjährung ist gesetzlich in § 78 StGB geregelt. Maßgeblich ist hierbei das jeweilige Höchstmaß einer in Betracht kommenden Strafe. Beim Hausfriedensbruch liegt dieses bei einer Freiheitstrafe bis zu einem Jahr. Länger kann ein Täter deswegen nicht hinter Gitter kommen. Zur Anwendung kommt demgemäß § 78 Absatz 3 Nummer 5 StGB, wonach die Verjährungsfrist einer Strafverfolgung beim Hausfriedensbruch drei Jahre beträgt.
Beginn der Frist ist laut § 78a StGB der Zeitpunkt der Beendigung der Tat bzw. der Erfolgseintritt.
Anzeige wegen Hausfriedensbruch: Was nun?

Wird eine Person wegen Hausfriedensbruch angezeigt und zudem ein entsprechender Starfantrag gestellt, steht sie unter Umständen vor der Frage, wie sie mit der Situation nunmehr umgeht. Anzuraten sei an dieser Stelle die Inanspruchnahme anwaltlicher Unterstützung. Die meisten Beschuldigten oder Angeklagten wissen nicht, wie sie sich am vorteilhaftesten verhalten sollten, im Hinblick auf die Abwendung einer (zu harten) Verurteilung.
Der ein oder andere hat sich hierbei schon im Rahmen von Vernehmungen um Kopf und Kragen geredet. Wer dies vermeiden will, sollte sich also an einen Anwalt mit Schwerpunkt Strafrecht wenden. Es gilt zudem: Je früher desto besser. Je zeitiger ein Anwalt involviert ist, umso weniger Fehler kann der Betroffene machen, die es dann wieder auszubügeln gilt.
Ein erfahrener Rechtsanwalt kennt nicht nur die Gesetzeslage und die herrschende Rechtsprechung zum Thema Hausfriedensbruch. Er kann zudem bereits im Ermittlungsverfahren Akteneinsicht beantragen und für Sie die bestmögliche Verteidigungsstrategie erarbeiten. Bei Hausfriedensbruch kann eine Geldstrafe in schmerzhafter Höhe drohen oder im schlechtesten Fall sogar eine Freiheitsstrafe. Wer dem entgegenwirken möchte, sollte sich also fachkundig beraten lassen. Auf die leichte Schulter genommen werden sollte der Vorwurf des Hausfriedensbruchs jedenfalls nicht.
Was tun als Opfer des Delikts „Hausfriedensbruch“?
Umgekehrt sollte derjenige, der zum Opfer einer Handlung gemäß § 123 StGB wird, dabei nicht tatenlos zusehen. Wer sich gegen einen ungebetenen Gast oder Eindringling nicht alleine zur Wehr setzen kann, sollte unbedingt die Polizei informieren. Diese kann den Störenfried notfalls mittels Zwang aus Ihren Räumlichkeiten entfernen. Auch in diesem Fall kann anwaltlicher Rat nicht schaden. Unter Umständen kommen hier, je nach Situation, Ersatzansprüche in Betracht, sofern Sie im Zuge der Tathandlung verletzt oder Gegenstände in Ihrer Wohnung beschädigt wurden.


 (58 Bewertungen, Durchschnitt: 4,16 von 5)
(58 Bewertungen, Durchschnitt: 4,16 von 5)
ich lebe in einen WG, ich habe einen sadistischen Nachbarn und genießen es, ihrem Nachbarn wehzutun. Letzte Nacht kam ihr drogenabhängiger und betrunkener Bruder in mein Zimmer, während ich schlief. Ich habe sogar die Polizei gerufen, aber die sagten nur, ich solle das Tor abschließen. Sollten die Bürger nicht über Sicherheit verfügen und sollten ihre Proteste nicht berücksichtigt werden?